Die Zukunft der Demokratie
„Heute haben die westlichen Demokratien sowohl mit einer Legitimitätskrise als auch mit einer Effizienzkrise zu kämpfen“: So diagnostizierte der belgische Historiker David Van Reybrouck schon vor rund einem Jahrzehnt den Krisenmodus der Demokratie. Die Signale für diesen Befund haben sich den vergangenen Jahren kontinuierlich verdichtet, von sinkenden Wahlbeteiligungen und Parteibeitritten bis zum Erstarken radikaler Kräfte, die offen die Demokratie bedrohen. Weltweit stehen liberale Demokratien heute unter Druck und wirken schwerfällig und schwunglos im Angesicht der Omnikrise.
Im 21. Jahrhundert ist die Demokratie strukturell mit erschwerten Bedingungen konfrontiert. Denn eine hochkomplex vernetzte Gesellschaft ist immer weniger in der Lage, das demokratische Grundversprechen einzulösen: die Einbeziehung aller Bürger:innen. In der Netzwerkgesellschaft kann Teilhabe nicht mehr garantiert werden, im Gegenteil: Netzwerke schließen alle aus, die nicht dazugehören. Auch deshalb agieren autoritäre Länder heute deutlich effizienter als demokratische Systeme.
Zudem bewirkt die Vernetzung eine mediale Fragmentierung, die einen echten öffentlichen Diskurs verhindert und polarisierende Tendenzen stärkt. Vor allem soziale Medien stellen unvereinbare Sichtweisen stärker denn je heraus und ermöglichen die unkritische Bestätigung jeweils eigener Positionen – zugunsten radikalisierter Kräfte. Auch die Verbreitung Fake News, zunehmend durch KI-Chatbots, wirkt destabilisierend. Je mehr dabei Deutungs- und Erfahrungsräume auseinanderfallen, umso verzerrter wird das Bild der öffentlichen Debatte. Und umso mehr kann sich die Vorstellung verfestigen, die Demokratie sei eine Art Dienstleister, dem man das Vertrauen entziehen kann, wenn die Ergebnisse nicht passen.
Doch so wie die Vernetzung das demokratische System herausfordert, setzt sie zugleich neue transformative Kräfte für eine demokratische Revitalisierung frei. Die zentralen Zukunftsfragen lauten dabei: Wie kann es der Demokratie gelingen, Bürger:innen nicht nur als Konsumierende, sondern als aktiv Mitgestaltende zu adressieren? Wie kann das politische System auch in der vernetzten Gesellschaft Teilhabe gewährleisten? Und welche Formen demokratischer Partizipation können dabei helfen?
Wie Demokratie erlebbar wird
Die Grundvoraussetzung für partizipative Maßnahmen in Richtung „mehr Demokratie“ ist ein Bewusstseinswandel im politischen System: die Erkenntnis, dass soziale Kräfte nur dann freigesetzt werden können, wenn entsprechende Handlungsspielräume bestehen, innerhalb derer sich bürgerliches Engagement überhaupt entfalten kann. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Umsetzung: Zentral sind Räume der Teilhabe, die mehr Bürgerbeteiligung und Austausch ermöglichen.
Viele konkrete Ideen für partizipative Formate werden bereits erfolgreich erprobt. Dazu zählt etwa das Konzept einer „Monitorial Citizenship“: Das kontinuierliche Monitoring von Regierungsaktivitäten durch Bürger:innen hilft, Misstrauen in politische Institutionen produktiv zu kanalisieren und zu reduzieren. Ähnliches ermöglicht die Open-Source-Software Consul Democracy: Städte und Stadtviertel können auf Basis von Behördendaten Wahlen oder Online-Abstimmungen durchführen und geplante Gesetzesvorhaben vorab diskutieren. Bürger:innen können zudem Vorschläge für Projekte einreichen, die sie mit öffentlichen Geldern umsetzen möchten. Das Programm wird bereits in 35 Ländern genutzt, darunter auch Deutschland.
Zahlreiche bürgerdemokratische Pionierprojekte belegen zudem, wie eine stärkere Bürgerbeteiligung die Akzeptanz politischer Entscheidungen und die Zustimmung zur Demokratie erhöht. So verbessern niedrigere Hürden für Volksbegehren und -entscheide oder Ämter wie eine „Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung“ nicht nur die Umsetzung zivilgesellschaftlicher Anliegen. Sie zeigen auch, dass mehr Teilhabe die Bürger:innen zufriedener und sozial engagierter macht. Länder, in denen Demokratie ständig erlebbar wird, weil Menschen an Entscheidungen beteiligt und zu konstruktiver Mitbestimmung aufgefordert sind, sind weniger demokratiefeindlich.
Brückenbau gegen die Polarisierung
Zunehmender Beliebtheit erfreut sich dabei die Wiederentdeckung der Losdemokratie. Von den Ursprüngen der Demokratie im alten Athen bis weit ins 18. Jahrhundert wurden die Mitglieder der Volksvertretung nicht gewählt, sondern ausgelost. Heute wird das Losprinzip zunehmend in Form von Bürgerräten umgesetzt. Dabei ermöglicht es eine echte Repräsentation der gesamten Gesellschaft und erzeugt eine hohe persönliche Verantwortung – sowohl für die zufällig ausgewählten Bürger:innen, die aktiv Lösungen entwickeln, als auch für die Politiker:innen, die mit diesen Lösungen weiterarbeiten.
Als Dialogformate mit offenem Ausgang eröffnen Bürgerräte einen Prozess, der die demokratische Kultur verwirklicht, indem er Bürger:innen aus ihren medialen Bubbles herauslöst. Das kann einen echten Mindshift bewirken: Fangen Menschen an, in einem gesicherten Rahmen miteinander über akute politische Herausforderungen zu reden, werden Vorurteile abgebaut, und die Wertschätzung gegenüber der Politik steigt. „Bürgerräte sind Schmelztiegel für harte Fronten“, sagt Claudine Nieth, Vorständin des Vereins „Mehr Demokratie“. In Deutschland wurde 2019 erstmals ein losdemokratischer Bürgerrat eingesetzt. Inzwischen hat der Bundestag eine eigene Stabsstelle für Bürgerräte geschaffen.
Bürgerräte sind ein Beispiel für neue Räume der Begegnung und des gemeinsamen Tuns, die Brückenschläge über die Gräben der Polarisierung ermöglichen. Diese Räume zu schaffen und auszubauen, ist elementar für die Demokratie im 21. Jahrhundert: als Zonen, in denen sich verschiedene Eigenlogiken gegenseitig irritieren und abgleichen können. Das leisten auch Initiativen wie „Deutschland spricht“, wo fremde Menschen zusammengebracht werden, um über Politik zu diskutieren, oder Wertedialoge wie die Z2X-Community. In die gleiche Richtung wirkt ein neues, konstruktives Verständnis von Journalismus, das auf Vermittlung und Verständigung zielt.
Next Politics: Mehr Bürgernähe, weniger Konfrontation
Für die politischen Parteien folgt daraus der Auftrag, stärker auf Austausch und Dialog anstatt auf Konfrontation und Rivalität zu setzen. Stellvertretend dafür steht das Prinzip der sogenannten Konkordanzdemokratie: Im Gegensatz zur vorherrschenden Konkurrenzdemokratie, in der Konflikte vor allem durch politische Mehrheiten und Parteien-Wettbewerb gelöst werden, zielt eine auf Konsens ausgerichtete Demokratie auf die Aushandlung von Kompromissen, um Unstimmigkeiten zu lösen. Vorreiter sind Luxemburg und die Schweiz, wo gemeinsam gefällte Beschlüsse von allen Regierungsmitgliedern nach außen vertreten werden. Die eigentliche Opposition bilden dann die Bürger:innen selbst, die mittels direkter Demokratie in den politischen Prozess eingreifen können.
Unterstützt werden könnte ein konsensorientiertes politisches Miteinander auch durch das Konzept der „Smart Governance“: die Auslagerung längerfristiger, komplexer Themen an kompetente Fachinstitutionen wie Think Tanks, Universitäten oder NGOs. Eine dezentrale und transparente Expertise fördert nicht nur die Balance zwischen operativer Unabhängigkeit und demokratischer Legitimation. Sie ermächtigt die Politik auch, Probleme nicht nur zu reparieren, sondern Themen proaktiv anzupacken.
Aktuell leidet die Demokratie vor allem darunter, dass sie zu wenig und zu selten erlebbar ist. Lediglich alle vier Jahre wählen zu können, reicht nicht aus, um ein Gefühl demokratischer Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und jüngere Bürger:innen – die Ressource der künftigen Demokratie – müssen in der Regel noch immer bis zum 18. Geburtstag warten, um überhaupt wählen zu dürfen. Auch generelle eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre wäre daher eine konkrete Maßnahme für mehr demokratische Resonanzerlebnisse.
Next State: Der Staat als Moderator
In einer partizipativen Demokratie entfaltet ein „aktivierender“ Sozialstaat demokratische Kräfte, indem er nicht nur klare Regulierungen setzt, sondern auch bessere Rahmenbedingungen schafft für mehr Eigeninitiative und Selbstorganisation. Erst wenn Menschen ermächtigt werden, eigenständig neue Formen von Partizipation zu realisieren, können auf breiter Basis neue Möglichkeiten eines übergreifenden, gemeinsamen Handelns entstehen – und neue Weltbilder jenseits populistischer Protestkulturen und ideologischer Grabenkämpfe.
Die Leitformel für demokratischen Zusammenhalt in der nächsten Gesellschaft lautet daher: mehr Selbstorganisation – innerhalb abgesicherter Rahmenbedingungen. Der Staat leistet dann gewissermaßen Hilfe zur Selbsthilfe, indem er es seinen Bürger:innen ermöglicht, sich selbst zu ermächtigen. Zum einen geschieht dies durch konkrete, praktische Projekte und Räume, die Dialoge und Begegnungen ermöglichen, neue Identitätsangebote vermitteln und eine Kultur der „kooperativen Abgrenzung“ fördern. Zum anderen durch verlässliche materielle Rahmenbedingungen, die es Menschen überhaupt erst ermöglichen, frei und freiwillig zu agieren.
Erst ein gewisser Standard an sozialer und finanzieller Absicherung ermöglicht wirksame Spielräume für selbstorganisiertes Handeln – so wie das Fehlen dieser Spielräume die Flucht in populistische, reaktionäre Ideen und Organisationen fördert. Daher braucht eine zukunftsfähige Demokratie auch neue Halteseile, die das Abweichen von altbekannten Pfaden ermöglichen und fördern, ohne Existenzen zu gefährden. Ideen für das Knüpfen solcher Halteseile bilden etwa die Konzepte eines Bedingungslosen Grundeinkommens und eines Bildungsgrundeinkommens oder auch der Vorschlag des französischen Ökonomen Thomas Piketty einer staatlich finanzierten „Erbschaft“ für alle 25-jährigen.
In der nächsten Gesellschaft wird die Rolle des Staates zunehmend die eines Moderators sein, der klare Regeln aufstellt und die kollektive Selbstorganisation unterstützt. Auf dieser Grundlage kann eine neue, konstruktive „Bürger:innen-Bewegung“ entstehen: Menschen, die sich stärker selbst organisieren und dabei aktiv unterstützt werden von einem Staat, der zwar Verantwortung übernimmt, aber erkennt, dass seine wahre Macht auf der Ermächtigung anderer beruht.
Next Democracy: Konstruktiv mit Komplexität umgehen
Die große Herausforderung für die Politik besteht künftig darin, mutige und realistische Angebote für einen konstruktiven Umgang mit einer hochkomplexen Gegenwart und Zukunft zu machen. Dass der Wille in der Bevölkerung dafür vorhanden ist, beweisen die großen Demonstrationen gegen das Erstarken rechtsradikaler, antidemokratischer Kräfte – ein mächtiges Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der Demokratie.
Die Idee der Demokratie lebt also weiter, auch und gerade im Zeichen der Omnikrise. Sie wächst durch jede einzelne Erfahrung, in der sie in der sozialen Alltagspraxis erlebbar wird – denn am Ende entscheidet sich immer im Kleinen, ob große Herausforderungen gelingen oder scheitern.
Der zentrale Faktor für gesellschaftlichen Zusammenhalt ist daher die Förderung einer partizipativen Demokratie, die das Gemeinsame erlebbar macht, ohne das Unterschiedliche auszublenden. Letztlich zielt dieser Transformationsprozess auf eine neue, kooperative(re) Gesellschaft: eine Co-Society, die das Verbindende betont und ein neues Miteinander stärkt. Den Grundstein dafür bildet eine vitale und handlungsfähige Demokratie, in der Politik und Bürger:innen einander ernst – um gemeinsam die großen transformativen Aufgaben unserer Zeit anzugehen.
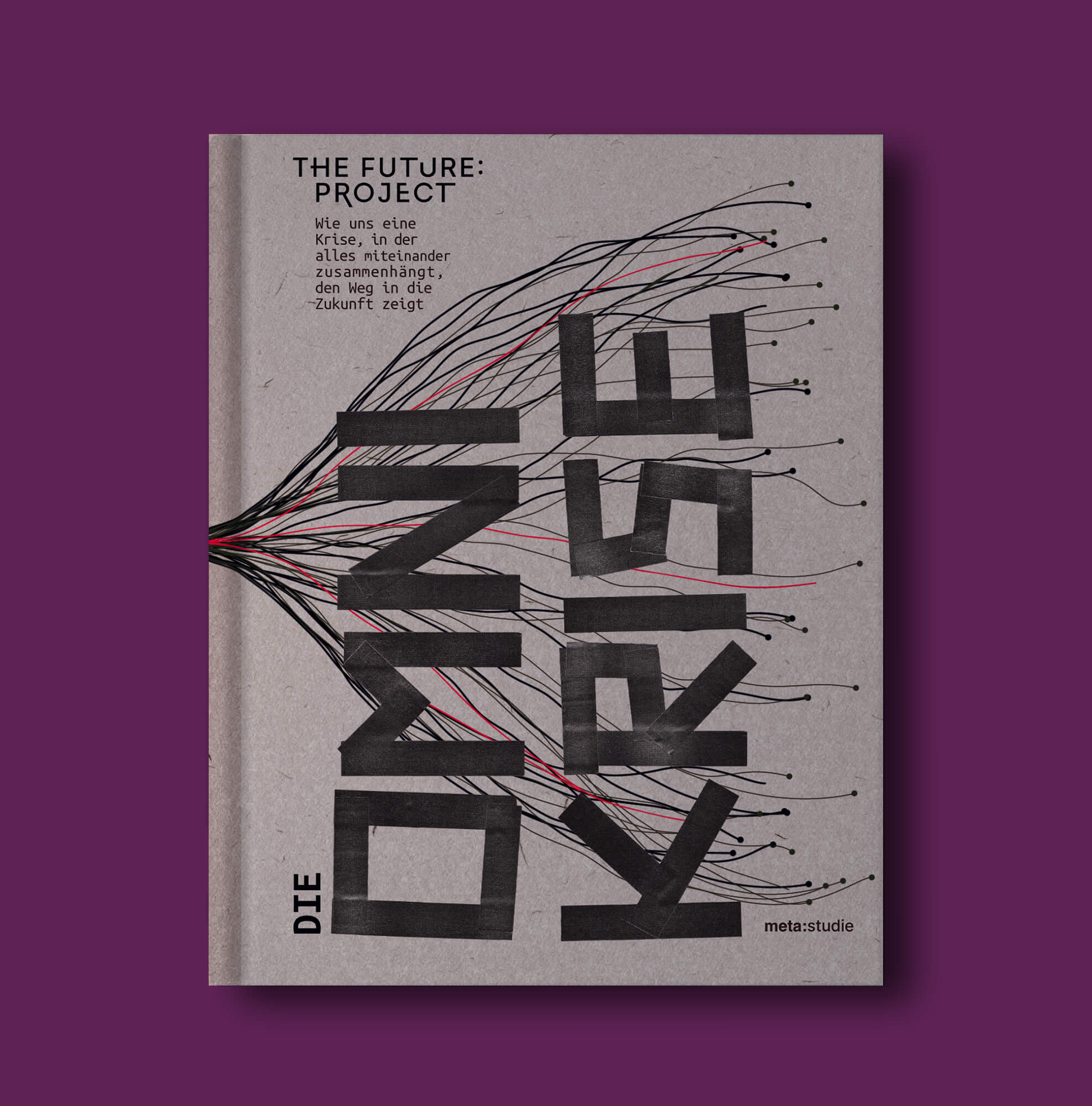
Die Omnikrise
Wie uns eine Krise, in der alles miteinander zusammenhängt, den Weg in die Zukunft zeigt.